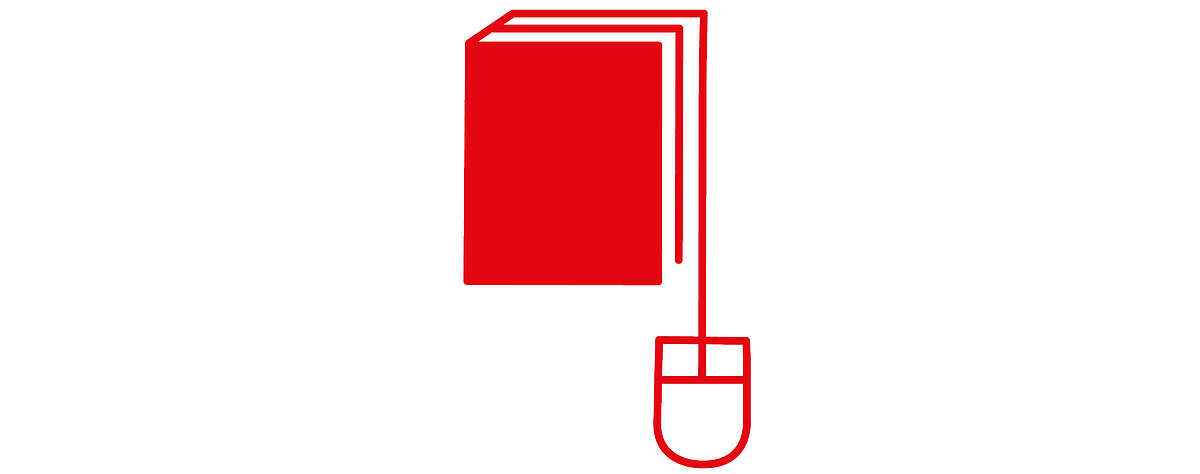KI-Agenten: Wie sie funktionieren – und was sie (noch nicht) können
KI-Agenten versprechen effizientere Abläufe durch vereinfachte Schreibprozesse, schnellere Recherchen oder eine passgenaue Ansprache im Autopiloten. Dieser Artikel zeigt Ihnen Leistungen und Nutzen von KI-Agenten. | Ein Beitrag von Simon Pollock, Retresco
Erstellt am 18.08.2025
Nach bald drei Jahren mit ChatGPT und vergleichbaren KI-Tools sind die Möglichkeiten inzwischen bekannt. Doch immer öfter fällt ein neuer Begriff: KI-Agenten. Was genau verbirgt sich dahinter? Wie funktionieren solche Agenten – und wodurch zeichnen sie sich aus?
Wie KI-Agenten den Arbeitsalltag verändern könnten
KI-Agenten gelten als nächster Schritt in der KI-Entwicklung. Im Unterschied zu den gängigen Tools, die einzelne Aufgaben auf Anweisung ausführen, können Agenten eigenständig Ziele verfolgen und Entscheidungen treffen – Schritt für Schritt, flexibel und angepasst an die jeweilige Konstellation. Sie agieren autonom, auch in einem komplexen und vielschichtigen Umfeld, und versprechen, ganze Prozessketten im Verlag automatisiert zu steuern.
Einfach gesagt, kann man sich einen KI-Agenten wie einen besonders fleißigen, digitalen Assistenten vorstellen, der nicht nur auf Befehle wartet, sondern auch selbst mitdenkt und handelt. Während herkömmliche KI-Anwendungen beispielsweise nur einen Text zusammenfassen oder eine E-Mail formulieren, kann ein KI-Agent eigenständig erkennen, welche Aufgaben erledigt werden müssen, Prioritäten setzen und sogar Rückfragen stellen, falls Informationen erforderlich sind.
KI-Agenten – selbstständig, lernfähig, zielorientiert
Was unterscheidet KI-Agenten von herkömmlicher Automatisierung und Workflows? Agenten sind Algorithmen, die nicht-deterministische Aufgaben eigenständig lösen. Das bedeutet, dass sie nicht immer nach dem gleichen Schema arbeiten, sondern selbstständig Lösungswege finden. Sie nutzen dafür alle verfügbaren Informationen und treffen Entscheidungen auf Basis von Daten. Sie planen, entscheiden und lernen selbstständig – zielorientiert und adaptiv. Ein KI-Agent könnte beispielsweise sagen: „Ich verstehe das Ziel und wähle selbst den besten Weg, um es zu erreichen – auch wenn ich den genauen Weg vorher nicht kannte.“
KI-Agenten sind der nächste große Schritt bei der intelligenten Steuerung von Prozessen. Sie können Inhalte personalisieren, Suchanfragen interpretieren und sich flexibel an wechselnde Anforderungen anpassen – ohne dass jeder Schritt im Vorfeld definiert werden muss. Hierbei ahmen sie in Ansätzen menschliches Entscheidungsverhalten nach.
Diese Autonomie bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich: Die Ergebnisse können gelegentlich unvorhersehbar oder unerwünscht ausfallen, da sie stark von der Datenbasis abhängen. Zudem liefern KI-Agenten ihre Resultate oft langsamer als automatisierte Systeme – weil Agenten bewerten, abwägen und kontinuierlich dazulernen.
Automatisierung – verlässliche, regelbasierte Abarbeitung von Aufgaben
Automatisierte KI-Systeme beruhen dagegen auf fest definierten Regeln und Abläufen. Entsprechende Algorithmen übernehmen wiederkehrende Aufgaben zuverlässig und effizient, zum Beispiel für Textgenerierung, Formatierung oder das Einfügen von Metadaten. Eine KI-gestützte Automatisierung folgt hierbei dem Prinzip: „Wenn A passiert, dann mach B.“ Sie arbeitet ohne Abweichungen, Interpretationen oder Flexibilität und sorgt so für eine stabile, skalierbare Umsetzung standardisierter Verlagsprozesse.
Automatisierung ist das einfachste, schnellste und zuverlässigste Verfahren des KI-Einsatzes. Solche Systeme sind ressourcenschonend und benötigen kaum menschliche Kontrolle. Allerdings sind automatisierte Systeme nicht lernfähig oder flexibel. Sobald abweichende Fälle oder neue Anforderungen auftreten, stoßen sie an ihre Grenzen – alles, was nicht explizit definiert wurde, bleibt unbearbeitet.
Workflows – Prozesssteuerung mit flexiblem Entscheidungsspielraum
KI-Workflows gehen einen Schritt weiter als automatisierte Systeme: Sie sind nicht nur regelbasiert, sondern auch kontextsensitiv und lassen sich flexibel in bestehende redaktionelle oder vergleichbare Abläufe integrieren. Anstelle reiner Ja/Nein-Entscheidungen können sie auch Wahrscheinlichkeiten und Abstufungen berücksichtigen, etwa: „Dieser Nutzer ist zu 72 % aktiv“ – also weder vollständig aktiv noch inaktiv. Workflows bringen Dynamik ins Spiel, können Muster erkennen und Entscheidungen treffen – etwa zur Leseaktivität, Themengewichtung oder Priorisierung von Inhalten.
Workflows verarbeiten komplexe Regeln und liefern gute Ergebnisse bei der klassifizierenden Verarbeitung von Daten. Sie können kontextabhängige Aufgaben automatisieren und strukturieren. Allerdings benötigen KI-Workflows meist themenspezifische Trainings, um präzise funktionieren zu können. Zudem sind ihre Entscheidungen nicht immer leicht nachvollziehbar und anpassbar – was menschliche Eingriffe erschweren kann.
Es lässt sich also festhalten: Automatisierung erledigt immer wiederkehrende Aufgaben zuverlässig nach festen Vorgaben. Workflows bringen mehr Flexibilität und können Entscheidungen je nach Situation anpassen. KI-Agenten gehen noch weiter: Sie arbeiten selbstständig, lernen dazu und finden auch für neue Aufgaben eigenständig Lösungen.
Exemplarisch: Wie ein Recherche-Agent im Verlagsumfeld arbeitet
In einem Verlag könnten KI-Agenten beispielsweise für die Themenrecherche genutzt werden, etwa bei einem neuen Sachbuch. Der KI-basierte Recherche-Agent übernimmt hierbei nicht nur das Sammeln von Informationen, sondern agiert zielgerichtet und eigenständig entlang eines strukturierten Rechercheprozesses – und das immer wieder neu:
- Verstehen des Rechercheziels
Der Agent analysiert zunächst die Vorgabe: Worum geht es? Welche Fragestellung soll beantwortet werden? Hierbei berücksichtigt er den Themenkontext, Zielgruppen und die gewünschte Tonalität – z. B. „Faktenbasierte Einordnung zur aktuellen Klimapolitik für ein populärwissenschaftliches Sachbuch“. - Eigenständiges Durchsuchen relevanter Quellen
Anschließend scannt der Agent vertrauenswürdige Online-Quellen, darunter Fachportale, Studien, Nachrichtenangebote oder wissenschaftliche Veröffentlichungen, wobei Aktualität, Relevanz und Seriosität miteinbezogen werden. - Bewertung der inhaltlichen Qualität
Der Agent filtert die Informationen nach Glaubwürdigkeit, Konsistenz und Tiefe. Widersprüchliche oder spekulative Inhalte werden markiert oder ausgeschlossen, wobei er auch die Reputation von Quellen und Autor*innen berücksichtigt. - Clustern und Priorisieren der Ergebnisse
Die gefundenen Informationen werden thematisch gruppiert und strukturiert. Der KI-Agent identifiziert zentrale Argumentationslinien, ordnet Nebenaspekte zu und gewichtet Themen nach Häufigkeit, Quellenvielfalt oder Relevanz für das Rechercheziel. - Zusammenfassung und Ausformulierung
Abschließend erstellt der Agent eine verständliche, zielgruppengerechte Aufbereitung – als Fließtext, Gliederung oder stichpunktbasierte Zusammenfassung. Hierbei achtet er auf Lesbarkeit sowie inhaltliche Ausgewogenheit und Korrektheit. - Bereitstellung und Nutzung
Die Ergebnisse werden regelmäßig per Alert, Dashboard oder Schnittstelle bereitgestellt, inklusive konkreter Quellenangaben, sodass die Adressaten die jeweiligen Informationen bei Bedarf nachprüfen oder vertiefen können.
Ein solcher Recherche-Agent könnte Verlage also spürbar entlasten, indem er eigenständig aktuelle, relevante und geprüfte Informationen zusammenträgt, strukturiert aufbereitet und jederzeit abrufbar macht – das spart Zeit und schafft Freiraum für kreative Aufgaben.
Welche KI-Agenten sind für Verlage sinnvoll?
Ob sich KI-Agenten in den nächsten Jahren durchsetzen, bleibt offen. Sie müssen ihren Mehrwert erst beweisen. Fünf Einsatzfelder, in denen besonders viel Potenzial liegt:
- Unterstützung bei der Redaktion & Content-Erstellung
- Erkennung relevanter Themen und Trends inkl. entsprechender Aufbereitung
- Unterstützung beim Lektorat, etwa indem die Konsistenz von Figuren- und Ortsnamen sichergestellt werden - Metadaten & Strukturierung
- Automatisierte Verschlagwortung und Taxonomie-Zuordnungen
- Themenklassifikationen und Metadatenanalysen
- Kuratierung und Inhaltsverwertung für Fachportale - Publishing & Produktion
- Formatkonvertierung für Multi-Channel-Publishing eingehender Manuskripte und Publikationen
- Manuskriptformatierung nach Verlagsvorgaben
- Erstellung von Factsheets und Landingpages - Marketing & Vertrieb
- Zielgruppenanalysen und Kampagnenoptimierungen
- Erstellung von Social-Media-Posts und Newslettern - Personalisierung & Interaktion
- Empfehlungssysteme für Artikel und Fachbücher
- Chatbots für interaktive Leser*innen-Anfragen
Was KI-Agenten künftig für Verlage leisten könnten
KI-Agenten befinden sich derzeit noch überwiegend in Pilotprojekten – ihr Potenzial ist aber nicht zu unterschätzen. Es geht nicht nur um die Automatisierung einzelner Arbeitsschritte, sondern um einen grundlegenden Wandel verlagsinterner Prozesse: weg von starren, manuellen Abläufen – hin zu dynamischen, datengetriebenen Systemen.
Hierbei entstehen neue Anforderungen. Entscheidungen von KI-Agenten müssen nachvollziehbar, überprüfbar und rechtlich einwandfrei sein – insbesondere bei der Nutzung sensibler Daten und urheberrechtlich geschützten Materials. KI sollte unterstützen, aber nicht unkontrolliert agieren.
Besonders in kleinen und mittelständischen Unternehmen fehlen häufig die notwendigen internen Kompetenzen, um KI-Projekte fachlich zu begleiten. Auch die entsprechende technische Infrastruktur, beispielsweise Schnittstellen oder Integrationen in bestehende Systeme, ist oft nicht vorhanden. Hinzu kommt, dass viele Inhalte in uneinheitlichen Formaten vorliegen oder über verschiedene Speicherorte verteilt sind – eine zentrale Datenhaltung ist selten vorhanden. Unter solchen Voraussetzungen lassen sich KI-Agenten nur schwer effizient umsetzen. Der Einsatz erfordert einen hohen technologischen Reifegrad sowie eine datengetriebene Organisationsstruktur.
Entscheidend sind die Fragen: Welche Aufgaben sollen an die KI abgegeben werden? Welche Daten stehen konsistent zur Verfügung? Und wie lässt sich die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine sinnvoll organisieren?
Der größte Hebel liegt aktuell nicht in neuen KI-Tools, sondern in der Weiterentwicklung bestehender Prozesse. Wenn diese Basis steht, können KI-Agenten echte Mehrwerte schaffen: Sie übernehmen Routineaufgaben, beschleunigen Abläufe – und schaffen Freiraum für kreative und inhaltliche Arbeit.
Sie haben Fragen, Feedback oder Interesse? Unter diesem Link können Sie mit uns in Kontakt treten. Wir freuen uns auf den Austausch!
Unsere Partner bieten Dienstleistungen und Beratung zu diesem Thema an: