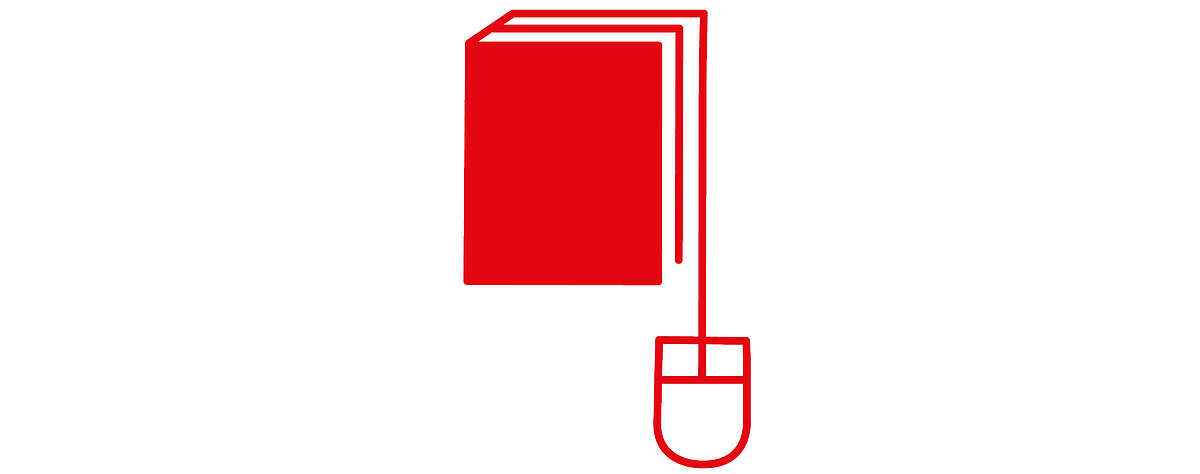E-Rechnung: Wann sie verpflichtend wird und welche Formate zulässig sind
Das Wachstumschancengesetz sieht u.a. die Einführung von E-Rechnungen im inländischen B2B-Bereich vor: Ab 1. Januar 2025 sollen alle Unternehmen verpflichtet sein, elektronische Rechnungen zu empfangen. | Ein Beitrag des Börsenvereins
Erstellt am 01.01.2025
Die Nutzung von E-Rechnungen bietet auch für unsere Branche erhebliche Möglichkeiten für effizienteres Arbeiten. Die Umstellung auf E-Rechnungen bedeutet aber auch Herausforderungen in technischer Hinsicht (Formate), in Form einer Integration in bestehende Systeme und in der Schulung von Mitarbeitenden.
Was versteht man unter einer E-Rechnung? Eine E-Rechnung ist eine Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird und eine elektronische Verarbeitung ermöglicht (gem. § 14 Abs. 1 Satz 3 UStG-E). Sie hat dem europäischen Rechnungsstandard EN16931 zu entsprechen.
Technische Anforderungen | Formate
Das Wachstumschancengesetz sieht vor, dass Rechnungen zukünftig ein strukturiertes elektronisches Format darstellen müssen, das der europäischen Norm für die elektronische Rechnungsstellung (et al.) entspricht.
Laut deutscher Finanzbehörden genügen sowohl Rechnungen nach dem
- XStandard als auch nach dem
- hybriden ZUGFeRD-Format (Kombination aus pdf-Dokument und XML-Datei, ab Version 2.0.1) diesen (umsatzsteuerlichen) Anforderungen. ZUGFeRD steht dabei für „Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland“.
Der Rechnungsversand erfolgt hier in Form eines PDF-Dokuments (= Sichtkomponente). Gleichzeitig wird ein inhaltlich identisches Mehrstück der Rechnung (XML) innerhalb des PDF mitversandt, so dass die elektronische Verarbeitung der Rechnung über die strukturierten Rechnungsdaten – nach Implementierung in das unternehmensspezifische Softwaresystem – problemlos möglich ist.
ZUGFeRD ermöglicht auch die Erstellung einer Rechnung ohne die begleitende PDF-Datei. Es ermöglicht zudem die von der Finanzverwaltung geforderte revisionssichere Archivierung. Voraussetzung ist dabei, dass die vorhandenen Informationen während der Aufbewahrungsdauer erhalten bleiben und nicht durch Dateiumwandlungen verringert werden.
Den technischen Anforderungen genügen nicht:
- Papierrechnungen
- pdf-Rechnungen
- ZUGFeRD 1.0
- nach aktuellem Stand: EDI-Verfahren (an Anpassungen wird gearbeitet)
Wann gilt was für wen?
Ab 1. Januar 2025 soll die grundlegende Verpflichtung zur Nutzung von E-Rechnungen bestehen. D.h. alle inländischen Unternehmen müssen nach dem aktuellen Entwurf des Wachstumschancengesetzes ab dem 1. Januar 2025 in der Lage sein, elektronische Rechnungen zu empfangen und zu archivieren. In diesen Fällen ist keine Zustimmung des Rechnungsempfängers mehr erforderlich, es sei denn, die elektronische Rechnung entspricht nicht den neuen Vorgaben oder es besteht keine E-Rechnungspflicht (z. B. bei bestimmten steuerbefreiten Umsätzen oder Kleinbetragsrechnungen).
Für den Zeitraum von 2025 bis 2027 sind Übergangsregelungen vorgesehen. Hierbei ist zwischen der Ausstellung und der Entgegennahme von Rechnungen zu unterscheiden:
- 2025 & 2026: Zwischen dem 1.1.2025 und 31.12.2026 kann zu einem ausgeführten Umsatz statt einer E-Rechnung auch eine sonstige Rechnung auf Papier oder in einem anderen elektronischen Format (mit Zustimmung des Empfängers) ausgestellt und übermittelt werden (§ 27 Abs. 39 Satz 1 Nr. 1 UStG-E). Diese Übergangsregel ist befristet bis zum 31.12.2026.
- In 2027 für kleinere Unternehmen: Für Rechnungen ausstellende Unternehmen, deren Gesamtumsatz im Jahr 2026 nicht höher als 800.000 € lag, gilt die Ausnahmeregel auch noch für 2027. Hierdurch sollen die Belange kleinerer Unternehmen berücksichtigt werden. Das heißt: Diese können für zwischen dem 1.1.2027 und vor dem 31.12.2027 ausgeführten Umsatz statt einer E-Rechnung auch eine sonstige Rechnung auf Papier oder in einem anderen elektronischen Format vorbehaltlich der Zustimmung des Empfängers ausstellen und übermitteln.
- Bis Ende 2027 soll es zudem erlaubt sein, statt einer E-Rechnung auch eine sonstige Rechnung in einem anderen elektronischen Format auszustellen, wenn diese mittels elektronischem Datenaustausch übermittelt wird (nach Artikel 2 der Empfehlung 94/820/EG der Kommission vom 19. Oktober 1994 über die rechtlichen Aspekte des elektronischen Datenaustausches, ABl. L 338 vom 28.12.1994, S. 98, sogenanntes EDI-Verfahren). Dies erfordert die Zustimmung des Empfängers.
- Das Wachstumschancengesetzt sieht eine zwingende Anwendung von E-Rechnungen ab dem 1.1.2028 vor - ohne Ausnahmen.
GLN für E-Rechnungen?
In manchen Fällen benötigen Unternehmen für die Erstellung einer E-Rechnung eine sogenannte GLN. Ob eine solche notwendig ist oder nicht, hängt von dem Übertragungsweg der E-Rechnung ab. Wenn Sie das EDI-Verfahren zur Übertragung von E-Rechnung nutzen, wird eine GLN benötigt. Diese wird jedem Mitglied aus der Fachgruppe Sortiment beim Eintritt in den Börsenverein zusätzlich zur debitorischen Verkehrsnummer zugeteilt, die im offiziellen Zuteilungsschreiben aufgeführt ist, das den Mitgliedern per Post zugeht.
Ebenso wie die Verkehrsnummern können auch die GLN sowohl bei der Mitgliedersuche im Mitgliederbereich als auch im Adressbuch für den Deutschsprachigen Buchhandel recherchiert werden. Für Rückfragen steht der Mitgliederservice gerne zur Verfügung.
Webinaraufzeichnung: E-Rechnung – Sind Sie bereit?
In einem Webinar beantworteten Michael Kursiefen, Schweitzer Fachinformationen, und Lisa Greuel, Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Fragen der Teilnehmenden und skizzierten die wichtigsten Schritte der Umstellung. Die Aufzeichnung des Webinars können Sie hier einsehen:
Unsere Partner bieten Dienstleistungen und Beratung zu diesem Thema an:
Das könnte Sie auch interessieren: